Kommunale Wärmeplanung in Bayern
Veranstaltungsreihe: Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung
Wir machen Sie fit!
Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie unterstützt in Kooperation mit dem Bayerischen Gemeindetag und dem Bayerischen Städtetag die bayerischen Städte und Gemeinden bei der Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung.
In der Veranstaltungsreihe "Umsetzung der kommunalen Wärmeplanung" wird dazu in jedem Regierungsbezirk eine Veranstaltung angeboten.
Weitere Informationen finden Sie im Flyer zur Veranstaltung. Zudem finden Sie alle Veranstaltungen im Veranstaltungskalender.
Die Veranstaltungsreihe richtet sich in erster Linie an kommunale Mitarbeiter vor Ort.
Ausgewählte Veranstaltungen werden im hybriden Format durchgeführt (Präsenz- oder Online-Teilnahme).
Nächste Veranstaltung
Leitfäden und Musterleistungsverzeichnisse zur Unterstützung
Im Rahmen des verkürzten Verfahrens können Kommunen, in denen keine Gas- und Wärmenetze vorhanden sind oder in denen der Wärmebedarf etwa aufgrund der Siedlungsstruktur gering ist, von einer Aufwandsreduzierung profitieren. Dies bedeutet, dass die Planung sich ausschließlich auf dezentrale Versorgungsgebiete konzentriert, was eine strukturelle Vereinfachung darstellt.
Dafür steht Ihnen zur Verfügung:
Das vereinfachte Verfahren richtet sich speziell an Kommunen mit weniger als 10.000 Einwohnern. Hierbei werden insbesondere die Datenerhebungs- und Berichtspflichten vereinfacht sowie Prozesse standardisiert. Dies führt zu einer prozessualen Vereinfachung, die den Kommunen die Umsetzung der Wärmeplanung erleichtert.
Dafür steht Ihnen zur Verfügung:
Am 1. Januar 2024 ist das Gesetz für Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG) in Kraft getreten. Damit wurden die gesetzlichen Grundlagen für eine verbindliche und systematische Einführung einer flächendeckenden Wärmeplanung geschaffen.
Rechtliche Grundlagen
Angebote zur Unterstützung
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet Kommunale Wärmeplanung?
Kommunale Wärmeplanung ist die Erstellung eines Planes, wie die Wärmeversorgung in einer Stadt oder einer Gemeinde klimaneutral in der Zukunft ausgestaltet werden kann. Hierbei geht es insbesondere um die langfristige Umstellung dezentraler fossiler Heizsysteme auf umwelt- und klimafreundlichere Wärmeversorgung.
Dazu werden insbesondere Gebiete mit dezentraler Wärmeversorgung, bestehende Wärmenetzgebiete oder Wasserstoffnetzgebiete auf ihre Um- und Ausbaumöglichkeiten hin untersucht.
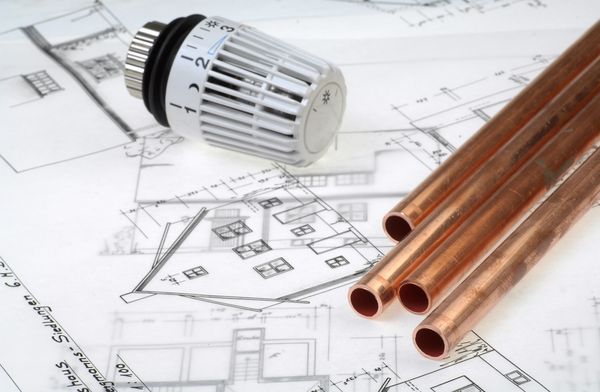

Warum Kommunale Wärmeplanung?
In der Diskussion der Möglichkeiten für eine rasche Energiewende hat der Wärmesektor neben der Stromerzeugung und dem Verkehrssektor bisher wenig Beachtung gefunden. Dies jedoch völlig zu Unrecht, da die Wärmeversorgung in Deutschland mehr als 50 Prozent des gesamten Energieverbrauchs ausmacht und deshalb auch für einen Großteil des CO2-Ausstoßes verantwortlich ist. Derzeit werden rund 80 Prozent des Wärmeverbrauchs durch fossile Energieträger wie Gas und Öl gedeckt. Dieser große Anteil an fossilen Brennstoffen hat nicht nur Auswirkungen auf den CO2-Ausstoß, sondern macht die Abnehmer auch abhängig von möglichen starken Preisanstiegen der hauptsächlich aus dem Ausland bezogenen fossilen Energieträger Gas und Öl.
Die kommunale Wärmeplanung soll helfen, den kosteneffizientesten und praktikabelsten Weg zu einer klimafreundlichen und langfristigen Wärmeversorgung vor Ort zu ermitteln.
Welche Vorteile bringt die Kommunale Wärmeplanung?
Von der Kommunalen Wärmeplanung können sowohl die Kommunen als auch die Hausbesitzer und Unternehmen profitieren.
Die Kommunen selbst können durch die klimaneutrale Wärmeerzeugung von Brennstoffimporten unabhängig werden und Ressourcen zur Wärmeerzeugung bestmöglich vor Ort nutzen. Ihren Einwohnern und Gewerbebetrieben können die Städte und Gemeinden eine Planbarkeit auf lange Sicht bieten. All das kann zur Steigerung der Attraktivität der Kommune als Wohnort und zur Ansiedlung von Gewerbe beitragen.
Hausbesitzer erhalten Planungssicherheit im Hinblick auf künftige Wärmeversorgungsoptionen. Beispielsweise kann ein Hausbesitzer auf die Installation einer Wärmepumpe oder Biomasseheizung verzichten, wenn sich als Folge der Kommunalen Wärmeplanung ergibt, dass das Gebiet, in dem sich das Haus befindet, zeitnah an ein Fernwärmenetz angeschlossen wird. Darüber hinaus können Hausbesitzer dadurch ebenfalls unabhängig von Brennstoffimporten und deren Preisschwankungen werden.


Umsetzung in Bayern
Verfassungsrechtlich ist eine direkte Übertragung von Aufgaben durch den Bund an die Kommunen nicht möglich. Deshalb werden mit dem WPG die Länder verpflichtet sicherzustellen, dass eine kommunale Wärmeplanung erstellt wird. In einem Flächenland wie Bayern ist eine zentrale Durchführung jedoch nicht sachgerecht. Hierzu fehlen dem Freistaat die nötigen Kenntnisse der konkreten Voraussetzungen in den Städten und Gemeinden. Die Wärmeplanung soll nicht von oben herab erstellt werden, sondern von und mit den örtlichen Akteuren. Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber im WPG die Kommunen bereits als Adressaten der Wärmeplanung vorgesehen. Der Freistaat hat dies aufgegriffen und die Kommunen als planungsverantwortliche Stellen der Wärmeplanung benannt.
Die dafür erforderlichen gesetzlichen Regelungen in Bayern wurden in die Verordnung zur „Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften“ aufgenommen und am 18. Dezember 2024 im Kabinett beschlossen. Sie sind am 2. Januar 2025 in Kraft getreten.
Umsetzung in Bayern
Die Landesagentur für Energie und Klimaschutz (LENK) ist Erstanlaufstelle für bayerische Kommunen zur kommunalen Wärmeplanung (erreichbar per E-Mail). Sie unterstützt die Kommunen im Planungsprozess durch Informationsvermittlung, Vernetzungsmöglichkeiten und Veranstaltungen. Dazu wird das Webangebot fortlaufend ausgebaut. Sukzessive werden Handreichungen zu folgenden Themenbereichen bereitgestellt:
- Die bayerischen Landesverordnung zur kommunalen Wärmeplanung
- Informationsblätter zur Durchführung der kommunalen Wärmeplanung in Bayern
- Informationsblätter zu Finanzierungsinstrumenten der Wärmetransformation auf kommunaler Ebene
- Informationsblätter zu Wärmeenergieträger und Technologien
- Erfahrungswerte zur kommunalen Wärmeplanung bzw. zur klimaneutralen Wärme-Transformation

Pressemeldungen
Weitere Pressemeldungen zum Thema finden Sie hier.
Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Für Kommunen
Grundlagen zur Kommunalen Wärmeplanung
Die Kommunale Wärmeplanung besteht nach dem WPG aus mehreren Schritten (vgl. WPG § 13) insbesondere sind dies:
1. Bestandsanalyse: In einem ersten Schritt wird der aktuelle „Ist-Zustand“ ermittelt. Es werden der aktuelle Wärmebedarf und -verbrauch, sowie die vorhandenen Wärmeerzeuger und Energieinfrastrukturen einer Gemeinde analysiert.
2. Potenzialanalyse: Im nächsten Schritt wird geprüft, welche möglichen Quellen für die Wärmeversorgung zur Verfügung stehen. Dies können erneuerbare Energien aber auch unvermeidbare Abwärmen sein.
Beispiel: die Abwärme aus einem lokalen Rechenzentrum; die Erschließung von Umweltwärme oder Abwasserwärme; Biomasse; Tiefengeothermie.
3. Zielszenarien und Umsetzungsstrategie: Der dritte Schritt erfolgt auf der Grundlage der Bestands- und Potenzialanalyse. Dabei soll für das beplante Gebiet in seiner Gesamtheit die langfristige Entwicklung zu einer auf erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme beruhenden Wärmeversorgung beschrieben werden. Die Kommune teilt das beplante Gebiet in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete ein und entwickelt konkrete Maßnahmen zur Umsetzung der Wärmeplanung.
4. Kommunaler Wärmeplan: In einem letzten Schritt fasst die Kommune die wesentlichen Ergebnisse der vorherigen Schritte zusammen.
Gemäß § 8 Abs. 3 AVEn ist das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht (LMG) als für den Vollzug des Wärmeplanungsgesetzes zuständige Behörde bestimmt worden.
Gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 15 WPG zählen zu den Quellen der Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energien solche ohne fossile Brennstoffe. Dies sind unter anderem: Geothermie, Umweltwärme, Abwasserwärme, Solarthermie, Biomasse, grünes Methan, grüner Wasserstoff, Strom aus erneuerbaren Energien und unvermeidbare Abwärme, beispielsweise aus Industrien, Abwasser und Rechenzentren.
Nein. Ein Wärmeplan im Sinne des WPG ist lediglich ein strategisches Planungsinstrument. Ein solcher führt daher nicht zu einer rechtlich verbindlichen Außenwirkung und begründet auch keine einklagbaren Rechte oder Pflichten.
Nein, ein Wärmeplan im Sinne des WPG führt daher nicht zu einer rechtlich verbindlichen Außenwirkung und begründet auch keine einklagbaren Rechte oder Pflichten. Dadurch ist eine Kommune durch den aufgestellten Wärmeplan nicht verpflichtet, ein Wärmenetz tatsächlich zu bauen.
Ja. Ein bereits bestehendes Wärmenetz entbindet nicht von der Pflicht, eine Kommunale Wärmeplanung durchzuführen. Bereits vorhandene Wärmenetze liefern Anknüpfungspunkte für die angestrebte Umstellung des Wärmesektors auf Treibhausgasneutralität und müssen daher in die konzeptionelle Betrachtung einbezogen werden.
Eine Ausnahme hiervon bildet § 14 Abs. 6 WPG: Beruht die Wärmeversorgung für ein beplantes Gebiet oder Teilgebiet vollständig oder nahezu vollständig auf erneuerbaren Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus, kann auf die Durchführung einer Kommunalen Wärmeplanung verzichtet werden.
Laut dem Leitfaden der Bundesregierung kann von einer „nahezu vollständigen“Versorgung mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme bei Anteilen von mehr als 75 Prozent ausgegangen werden, wenn die vollständige Versorgung mit erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme ohne Maßnahmen, die mit erheblichem Planungs- und Umsetzungsaufwand verbunden sind, erreicht werden kann. Das ist etwa der Fall, wenn kein Aus- oder Umbau von Infrastrukturen erforderlich ist. Wird beispielsweise nur die Spitzenlast über fossile Kessel mit fossilen Brennstoffen erzeugt, die perspektivisch durch erneuerbare Brennstoffe ersetzt werden, ist ein „nahezu vollständig“ gegeben.
Beispiel: Soweit eine über 75-prozentige Wärmeversorgung durch Geothermie als erneuerbare Energie (vgl. § 3 Abs. 1 Nr. 15 WPG) im jeweiligen (Teil-)Gebiet gegeben ist, kann eine Wärmeplanung entfallen.
Daraus folgt: Grundsätzlich ist eine Durchführung der Kommunalen Wärmeplanungauch bei einem bereits bestehenden Wärmenetz erforderlich. Etwas anderes kann gelten, wenn die Voraussetzungen von § 14 Abs. 6 WPG gegeben sind.
Eine bereits vorhandene Wärmenetzversorgung hat für die Gemeinde im Hinblick auf die Kommunale Wärmeplanung positive Folgen, da sich daraus einige Planungserleichterungen ergeben. So wird sich eine bereits vorhandene Wärmeversorgung beispielsweise für die Beschreibung des Zielszenarios gem. § 17 WPG i.V.m. Anlage 2 WPG und auch für die Szenarienbetrachtung im Rahmen der §§ 18 und 19 WPG vereinfachend auswirken.
Darüber hinaus kann im Rahmen der Wärmeplanung der Ausbau vorhandener Wärmenetze geprüft und in Folge damit über die Ausweisung weiterer (Teil-)Gebiete als Wärmenetzversorgungsgebiet entschieden werden.
Aus diesem Grund ist die Erfassung bereits bestehender, konkret geplanter oder genehmigter Wärmenetze wesentlicher Teil der Bestandsanalyse gem. § 15 WPG i.V.m. Anlage 1 WPG. Das Vorliegen einer bereits zu 100% über Wärmenetze versorgten Gemeinde kann auch sinnvoller Anknüpfungspunkt für eine gemeinsame Wärmeplanung von mehreren Gemeinden gem. § 4 Abs. 3 S. 2 WPG sein. Auf unsere Unterstützungsleistung zur gemeinsamen Wärmeplanung (Kurz-ENP) wird in diesem Zusammenhang verwiesen.
Beruht die Wärmeversorgung für ein beplantes Gebiet oder Teilgebiet vollständig oder nahezu vollständig auf erneuerbaren Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus, kann gem. § 14 Abs. 6 WPG auf die Durchführung einer Kommunalen Wärmeplanung sogar verzichtet werden.
Nein. Das Wärmeplanungsgesetz regelt in § 6 S. 2 die Möglichkeit für planungsverantwortliche Stellen, zur Unterstützung bei der Erfüllung der Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung Dritte zu beauftragen. Weder das WPG noch die AVEn enthalten eine Regelung, welche Kriterien ein Dienstleister zu erfüllen hat. Es obliegt der Planungsverantwortlichkeit der Gemeinden, ob und welchen Dienstleister sie heranziehen. In diese Planungsverantwortlichkeit wird nicht eingegriffen. Die Gemeinden sind durch die Konnexitätszahlungen jedoch finanziell so ausgestattet, dass ein qualitativ hochwertiger Plan möglich sein sollte.
Kostenerstattungen und Auszahlungen
Mit der neuen Aufgabe der kommunalen Wärmeplanung entstehen den Städten und Gemeinden zusätzliche Kosten für die Erstellung der Fachgutachten sowie Verwaltungs- und Personalkosten. Diese werden seitens des Freistaats ausgeglichen. Der Kostenausgleich wurde zwischen dem Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie sowie dem Bayerischen Städtetag und dem Bayerischen Gemeindetag aufgrund eines festen Verfahrens ausgehandelt. Grundlage bildet eine detaillierte Kostenschätzung.
Im Ergebnis wird der Freistaat den Gemeinden rund 79 Mio. Euro bis 2028 für die Erstellung der kommunalen Wärmepläne erstatten. Darüber hinaus erhalten die bayerischen Städte und Gemeinden weitere 35 Mio. Euro durch die Bundesförderungen für die kommunale Wärmeplanung (sog. ZUG-Förderung). Für die Auszahlung der Kostenerstattung ist das Bayerische Landesamt für Maß und Gewicht (LMG) zuständig. Die Auszahlung erfolgt in zwei Tranchen, zu Beginn der Wärmeplanung auf Antrag der Gemeinde sowie nach Einreichung des erstellten Wärmeplans. Einzureichen ist nur der finale Wärmeplan. Alle übrigen vom WPG vorgeschriebenen Veröffentlichungen (d.h. Eignungsprüfung, Bestands- und Potenzialanalyse sowie der Entwurf) sind nicht an das LMG zu übermitteln. Ergänzende Informationen zu den Auszahlungsmodalitäten erhalten die Kommunen im ersten Quartal 2025.
Ja, ein Beginn noch vor Abruf der Konnexitätszahlung steht dieser nicht entgegen.
Einzureichen ist nur der finale Wärmeplan am Ende der Planung. Alle übrigen vom WPG vorgeschriebenen Veröffentlichungen (d.h. Eignungsprüfung, Bestands- und Potenzialanalyse sowie der Entwurf) sind nicht an das LMG zu übermitteln.
Das entsprechende Online-Tool zur Einreichung und Beantragung der Ausgleichszahlungen wird derzeit erstellt. Ergänzende Informationen zu den Auszahlungsmodalitäten erhalten die Kommunen im zweiten Quartal 2025.
Bei der Kostenerstattung wurde besonderes Augenmerk auf die spezifischen bayerischen Gegebenheiten mit vielen kleinen Gemeinden gelegt. Das bayerische Berechnungsmodell unterteilt – abweichend von den Bundesvorgaben – die Gemeinden unter 10.000 Einwohner nochmals in vier Gruppen. Bei den Gemeinden über 100.000 Einwohner erfolgt ebenfalls eine größere Differenzierung.
Die entstehende Mehrbelastung wird den Gemeinden nach Einwohnerzahl pauschaliert wie folgt ausgeglichen (maßgeblich für die Einwohnerzahl ist der Stichtag 31.12.2023 aus dem Berichtsjahr 2023 mit der Basis Zensus 2022 des LfStat Download der Zahlen als Excel-File).
| Einwohnerzahl | Gemeinden mit Wärmeplanungspflicht nach § 4 Abs. 1 WPG | Gemeinden mit bestandsgeschütztem Wärmeplan nach § 5 Abs. 2 WPG1 (bspw. „ZUG-Förderung“) |
| < 2.500 | 34.800,00 Euro | 9.600,00 Euro |
| 2.500 <= x < 5.000 | 41.000,00 Euro | 9.600,00 Euro |
| 5.000 <= x < 7.500 | 52.100,00 Euro | 13.100,00 Euro |
| 7.500 <= x < 10.000 | 88.200,00 Euro | 16.700,00 Euro |
| 10.000 <= x < 45.000 | 122.600,00 Euro | 16.700,00 Euro |
| 45.000 <= x < 100.000 | 201.100,00 Euro | 23.200,00 Euro |
| 100.000 <= x < 250.000 | 262.000,00 Euro | 25.500,00 Euro |
| 250.000 <= x < 500.000 | 362.000,00 Euro | 25.500,00 Euro |
| 500.000 <= x | 562.000,00 Euro | 25.500,00 Euro |
Es ist davon auszugehen, dass ca. 640 Gemeinden hierunter fallen.
Das BMWK hat inzwischen die Vollzugspraxis nochmals überprüft: Wärmepläne, für die in Folge der Bestandsschutzregelung des § 5 Abs. 2 WPG keine Pflicht zur Wärmeplanung besteht, können weiterhin gefördert werden. Voraussetzung ist, dass
- die förderfähigen Förderanträge vor dem 1. Januar 2024 gestellt wurden und
- der Wärmeplan bis zum 30. Juni 2026 erstellt wird.
Es ist deshalb dringend zu empfehlen, mit ausreichend zeitlichen Puffern an die Planung heranzugehen, um diese Zeitgrenze einhalten zu können. Für eine Erstellung der geförderten Wärmepläne stellt das KWW ein Musterleistungsverzeichnis auf seiner Webseite zur Verfügung: KWW-Musterleistungsverzeichnis Kommunale Wärmeplanung - Kompetenzzentrum Kommunale Wärmewende.
Bei den Kommunen mit einer ZUG-Förderung werden die Verwaltungsaufwände entsprechend der obenstehenden Tabelle ausgeglichen. Ein Ausgleich für die Kosten zur Erstellung der Fachgutachten ergeht nicht, dies erfolgt aus der Bundesförderung der NKI.
Konvoiplanung
Durch einen Zusammenschluss aneinander angrenzender Gemeinden zur Durchführung einer gemeinsamen Wärmeplanung können erhebliche Synergien realisiert werden. Gerade im Flächenland Bayern mit seinen vielen kleineren Gemeindegebieten ist der Zusammenschluss zu einem gemeinsamen Planungskonvoi ein sinnvolles Instrument zur Effizienzhebung. Synergien ergeben sich sowohl auf der reinen administrativen Planungsebene (z.B. gemeinsame Akteursbeteiligung) wie auch in einer möglichen effizienteren Nutzung vorhandener Wärmepotenziale (z.B. Tiefengeothermie oder unvermeidbare Abwärme). Daher ist es in jedem Falle sinnvoll, wenn in einem Gemeindegebiet Wärmepotenziale für eine leitungsgebundene Versorgung über die Gemeindegrenzen hinweg vorliegen, mit den angrenzenden Gemeinden hinsichtlich einer gemeinsame Wärmeplanung in Kontakt zu treten.
Insbesondere für kleinere Kommunen unter 10.000 Einwohner bietet sich der Zusammenschluss zu einem Konvoi an. Hier unterstützen wir seit Anfang Juni 2024 gezielt mit der Erstellung einer Vorprüfung im Rahmen eines sogenannten „Kurz-Energienutzungsplans (Kurz-ENP)“.
Informationen zum Kurz-ENP finden Sie auf der ENP Online-Website unter Förderhinweise. Eine Konvoiplanung hat keine Auswirkungen auf die Auszahlung der Konnexitätsmittel. Jede Gemeinde erhält den ihr nach der Konnexitätsvereinbarung zustehenden Betrag, unabhängig von einer Konvoiplanung.
Um wichtige Planungsprozesse, wie z.B. die Akteursbeteiligung, noch in einem angemessenen Umfang und Detailgrad gewährleisten zu können, sollte ein Planungskonvoi eine gewisse Größenordnung nicht überschreiten. Eine sinnvolle Begrenzung ist stark einzelfallabhängig. Als Orientierung für eine diesbezügliche Obergrenze kann jedoch von bis zu 10 bis 12 Konvoigemeinden ausgegangen werden.
Als Formen der interkommunalen Kooperation für eine gemeinsame Wärmeplanung nach KommZG kommen insbesondere in Betracht:
- Zweckvereinbarung gem. Art. 7 KommZG,
- Übertragungsvereinbarung gem. Art. 7 Abs. 2 KommZG,
- Gemeinschaftsvereinbarung gem. Art. 7 Abs. 3 KommZG,
- Einfache Arbeitsgemeinschaft gem. Art. 4 KommZG,
- Besondere Arbeitsgemeinschaft gem. Art. 5 KommZG,
- Verwaltungsgemeinschaften oder
- Zweckverbände.
Jede Gemeinde hat weiterhin ihren individuellen Anspruch auf Auszahlung der Konnexitätsmittel. Die Konvoiplanung hat keine Auswirkung darauf.
Weitere Unterstützungsleistungen durch den Freistaat
Um die Gemeinden möglichst umfassend bei ihrer neuen Aufgabe zu unterstützen, hat das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie verschiedene Unterstützungsangebote erarbeitet, die den Städten und Gemeinden voraussichtlich noch im ersten Quartal des Jahres 2025 zur Verfügung gestellt werden.
- Bei der Durchführung des vereinfachten Verfahrens (betrifft Gemeinden unter 10.000 Einwohnern) wurde ein Leitfaden sowie ein Musterleistungsverzeichnis zur Beauftragung von Fachplanern erstellt.
- Jede bayerische Gemeinde erhält ein Kurzgutachten über den Stand der Wärmeversorgung in ihrem Gemeindegebiet. Dieses dient als wesentliche Entscheidungshilfe für die Eignungsprüfung und damit zur Durchführung einer verkürzten Wärmeplanung in Gebieten, die sich nicht für eine zentrale Wärmeversorgung eignen.
- Die Eignungsprüfung kann zur Durchführung eines verkürzten Verfahrens berechtigen, was grundsätzlich für alle bayerischen Gemeinden unabhängig von ihrer Größe möglich ist. Voraussetzung ist, dass es in der Gemeinde Teilgebiete gibt, die sich nicht für eine zentrale Wärmeversorgung oder eine Wasserstoffnetz eignen. In diesen Teilgebieten kann in einem verkürzten Verfahren auf einen Teil der Planungsschritte verzichtet werden. Auch für das verkürzte Verfahren wurde den Gemeinden ein Leitfaden und ein entsprechendes Musterleistungsverzeichnis zur Verfügung gestellt.
- Jede bayerische Gemeinde erhält als Planungsgrundlage geodatenbasierte Datenpakete zu den Wärmebedarfen im jeweiligen Gemeindegebiet.
- Des Weiteren wird für jede Gemeinde ein Paket an Planungsdaten bereitgestellt, aus dem sich Informationen zu den Wärmebedarfen vor Ort ergeben. Zur Datenübermittlung wird eine Secure-Box „kommunale Wärmeplanung“ für jede Kommune eingerichtet. Hierzu ergeht eine Kontaktaufnahme Anfang 2025 durch das Landesamt für Statistik.
- Mit der Förderung von sog. Kurz-ENPs werden Gemeinden bei der Vorabanalyse für die interkommunalen Wärmeplanung unterstützt. Das Förderprogramm wurde bereits im Juli 2024 gestartet (Förderhinweise - ENPOnline)
- Ab dem zweiten Quartal 2025 werden in jedem RegierungsbezirkInformationsveranstaltungen zur kommunalen Wärmeplanung von der Bayerischen Verwaltungsschule (BVS) durchgeführt. Zielsetzung ist, die Gemeinden über die bevorstehenden Aufgaben zu informieren und das Verwaltungspersonal vor Ort zu schulen. Mit einer beihilfefreien Finanzierungsförderung für Wärmenetzsysteme durch die LfA-Förderbank Bayern in Kombination zur Bundesförderung (BEW) werden bereits Umsetzungsschritte der Wärmeplanung in den Fokus genommen und unterstützt. Zum 14.02.2025 ging mit diesem Energiekredit Wärme ein Unterstützungsinstrument der LfA-Förderbank Bayern für Investitionen in Wärmenetze an den Start. Näheres in nachfolgender Pressemitteilung und dem entsprechenden Programmmerkblatt.
Vereinfachtes Verfahren
Für Gemeinden unter 10.000 Einwohnern wurde ein vereinfachtes Verfahren eingeführt. Das vereinfachte Verfahren bezieht sich auf den gesamten Wärmeplan einer Gemeinde und sieht eine generelle Vereinfachung des Planungsprozesses (z. B. reduzierte Ergebnisdarstellung und Methodik, Verzicht auf vereinzelte Datenerhebungen, Standardisierung von Prozessen) vor. Die Darstellung der Ergebnisse und das methodische Vorgehen werden vereinfacht und in der Komplexität reduziert, auf vereinzelte Datenerhebungen wird verzichtet. Auch Prozesse werden verringert und standardisiert.
Grundsätzlich bleibt aber die Entscheidung, ob und in welcher Ausprägung das vereinfachte Verfahren genutzt werden soll, in den Händen der Gemeinden. Das vereinfachte Verfahren kann neben dem verkürzten Verfahren zur Anwendung kommen. Hierzu hat das Bayerische Wirtschaftsministerium einen Leitfaden und ein Musterleistungsverzeichnis veröffentlicht.
Verkürztes Verfahren
Im verkürzten Verfahren können gem. § 14 Abs. 4 WPG einzelne Prozessschritte der kommunalen Wärmeplanung ausgelassen werden. Dort wo kein Wärmenetz oder Gasnetz besteht, kann das verkürzte Verfahren zur Anwendung kommen.
Das verkürzte Verfahren soll sich insbesondere an die Kommunen richten, deren Gemeindegebietsstruktur mehr für eine dezentrale (also Einzelheizungen) als eine zentrale Wärmeversorgung spricht. Das vom Wirtschaftsministerium bereitgestellte Kurzgutachten gibt Orientierung, ob sich das Gemeindegebiet für die verkürzte Wärmeplanung eignet.
Der Verein der bayerischen Energieagenturen hat im Auftrag des Bayerische Wirtschaftsministeriums für das „Verkürzte Verfahren“ einen Leitfaden und ein Musterleistungsverzeichnis für die betroffenen Kommunen erstellt.
Bereits vorliegender Energienutzungsplan/Wärmeplan
Bayerische Energienutzungspläne und Wärmepläne können auf Grundlage des WPG anerkannt werden, wenn die folgenden Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 WPG gemeinsam erfüllt sind:
- Am 1. Januar 2024 lag ein Beschluss oder die Entscheidung über die Durchführung des Energienutzungsplans/der Wärmeplanung vor,
- spätestens bis zum Ablauf des 30. Juni 2026 wird der Energienutzungsplan/Wärmeplan erstellt und veröffentlicht und
- die dem Wärmeplan zugrundeliegende Planung ist mit den Anforderungen des WPG im Wesentlichen vergleichbar. Für geförderte Energienutzungspläne/Wärmepläne (bspw. Förderung durch die Kommunalrichtlinie) gilt hier eine Vermutungswirkung hinsichtlich der Vergleichbarkeit.
Zu 1.:
Das WPG lässt eine „Entscheidung“ der planungsverantwortlichen Stelle ausreichen. Damit ist für die Anwendbarkeit der Bestandsschutzregelung des § 5 Abs. 2 also insbesondere kein formeller Beschluss der planungsverantwortlichen Stelle notwendig. Es kann daher im Einzelfall ausreichen, wenn eine Entscheidung für die Durchführung einer Wärmeplanung anderweitig nachvollziehbar getroffen wurde, z.B. durch Stellen eines entsprechenden Förderantrages, wie die Antragstellung im Rahmen der Kommunalrichtlinie.
Zu 2.:
Das Vorliegen der Voraussetzung nach Nr. 2 kann erst am 30. Juni 2026 final festgestellt werden. Für die Anwendbarkeit der Bestandsschutzregel ist es unerlässlich, dass die Fertigstellung und Veröffentlichung fristgerecht erfolgt. Es ist daher dringlich zu empfehlen, mit ausreichenden zeitlichen Puffern an die Planung heranzugehen, um nicht während der Planung aus dem Bestandsschutz nach § 5 Abs. 2 WPG zu fallen und den unter Umständen umfangreicheren Voraussetzungen der Wärmeplanungspflicht nach § 4 WPG zu unterfallen.
Zu 3.:
Für die Vergleichbarkeit nach Nr. 3 finden sich in § 5 Abs. 2 Satz 2 WPG Regelbeispiele.
- Wenn die Erstellung des Wärmeplans/Energienutzungsplans Gegenstand einer Förderung mit Mitteln des Bundes oder des Landes war.
- Wenn der Wärmeplan/Energienutzungsplan unter Heranziehung der Standards erstellt wurde, die sich aus den in der Praxis verwendeten Leitfäden ergeben. Hierzu gehören etwa Leitfäden, die von den zuständigen Stellen der Länder, von Verbänden oder Forschungseinrichtungen veröffentlicht worden sind und eine methodische Grundlage oder weitere praktische Hilfestellungen für die Wärmeplanung enthalten.
Eine Vergleichbarkeit kann im Einzelfall prinzipiell auch unabhängig von den Regelbeispielen des § 5 Abs. 2 S. 2 WPG vorliegen, wenn
- im Rahmen einer Bestandsanalyse die bestehenden Wärmeverbräuche oder Wärmebedarfe innerhalb des maßgeblichen Gebiets ermittelt,
- die vor Ort vorhandenen Potenziale für die Einbindung erneuerbarer Energien oder unvermeidbarer Abwärme untersucht wurden und
- der Wärmeplan dazu Aussagen enthält, in welchen Teilen des maßgeblichen Gebiets welche Art der Wärme- oder Energieversorgung zukünftig eine Rolle spielen soll.
- Zudem sollten Umsetzungsmaßnahmen untersucht worden sein.
Die Vorgaben, die das WPG an die Wärmeplanung stellt, müssen diese anerkannten Energienutzungspläne und Wärmepläne erst bei ihrer Fortschreibung einhalten.
Erfahrungsgemäß dürften landkreisweite Energienutzungspläne aufgrund des räumlich weit gefassten Untersuchungsrahmens einen zu hohen Abstraktionsgehalt aufweisen, um als geeigneter Wärmeplan im Sinne des WPG für die jeweiligen planungsverantwortlichen Gemeinden angesehen zu werden. Wegen der oben genannten Flexibilität des Förderprogramms sind anders gelagerte Einzelfälle allerdings auch nicht ausgeschlossen.
Soweit das vorliegende Konzept auch Analysen und Aussagen auf das maßgebliche Gemeindegebiet enthält, können grundsätzlich auch interkommunale Energienutzungspläne Grundlage einer solchen Anerkennung sein. In diesem Zusammenhang ist allerdings zu bedenken, dass ein Wärmeplan im Sinne des WPG über ein bloßes Wärmekataster hinausgeht. Vielmehr muss die planungsverantwortliche Gemeinde vor allem u.a. vor dem Hintergrund der Entscheidung über die Ausweisung von Netzgebieten gem. § 26 WPG auch eine entsprechende Einteilung des beplanten Gebiets in voraussichtliche Wärmeversorgungsgebiete erkennen können. Eine Orientierung darüber, welche Inhalte zu einer wesentlichen Vergleichbarkeit im Sinne des § 5 Abs. 2 WPG beitragen, wird in der Gesetzesbegründung des WPG gegeben (vgl. BT-Drs. 20/8654 S. 88).
Hiernach setzt eine Vergleichbarkeit voraus,
- dass im Rahmen einer Bestandsanalyse die bestehenden Wärmeverbräuche oder Wärmebedarf innerhalb des maßgeblichen Gebiets ermittelt wurden,
- dass die vor Ort vorhandenen Potenziale für die Einbindung erneuerbarer Energien oder unvermeidbarer Abwärme untersucht wurden und
- dass der Wärmeplan dazu Aussagen enthält, in welchen Teilen des maßgeblichen Gebiets welche Art der Wärme- oder Energieversorgung zukünftig eine Rolle spielen soll.
- Zudem sollten Umsetzungsmaßnahmen untersucht worden sein.“
Die Gemeinden sind verpflichtet, für ihr jeweiliges Gemeindegebiet allein oder gemeinsam mit anderen Gemeinden Wärmepläne nach Maßgabe des WPG zu erstellen, soweit die Pflicht zur Wärmeplanung nicht gem. § 5 Abs. 2 WPG entfällt. Die Abwägung darüber, ob ein bereits vorliegender kommunaler oder landkreisweiter Energienutzungsplan als bestandsgeschützter Wärmeplan nach § 5 Abs. 2 WPG angesehen werden kann, ist auf Gemeindeebene vorzunehmen.
Haben sich mehrere Gemeinden zum Zwecke der Wärmeplanung im Rahmen der kommunalen Zusammenarbeit zu einer gemeinsamen Planung zusammengeschlossen, kann diese Abwägung auch auf Ebene des Zusammenschlusses erfolgen – grundsätzlich jedoch nicht auf Landkreisebene, da die Gemeinden als planungsverantwortliche Stelle diese Abwägung eigenverantwortlich vorzunehmen haben.
WPG und GEG
Die Fristen des GEG zum 65-Prozent-Erfordernis greifen
- Mit Ablauf der Fristen, die das GEG vorgibt (§ 71 Abs. 8 GEG, siehe weiter unten) oder
- Wenn die Gemeinde nach Erstellung eines Wärmeplans i.S.d. WPG eine Entscheidung zur Ausweisung eines Neu- oder Ausbaugebiets von Wärmenetzen oder Wasserstoffnetzen trifft.
Dann: einen Monat nach Erlass dieser Entscheidung
Wichtig: Die Entscheidung zur Ausweisung eines Neu- oder Ausbaugebietes von Wärme- oder Wasserstoffnetzen erfolgt gesondert von der Erstellung eines kommunalen Wärmeplans und liegt in der freien Entscheidung der Gemeinde. Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung.
Daraus folgt:
- Es gibt keine Verpflichtung zum Erlass einer Ausweisungsentscheidung.
- Ohne eigenständige Ausweisungsentscheidung gelten die Fristen des GEG.
Für die Frage, wann das 65 Prozent-Erfordernis gilt, ist also zwischen der Erstellung des Wärmeplans und der Entscheidung über die Ausweisung eines Neu- oder Ausbaugebietes eines Wärmenetzes bzw. Wasserstoffnetzes zu unterscheiden. Das Erfordernis von 65 Prozent erneuerbarer Energien an der bereitgestellten Wärme für neu einzubauende Heizungen ist in § 71 Abs. 1 GEG geregelt. Hierauf nimmt das WPG Bezug, um beide Gesetze samt Fristen zu „verzahnen“. Der Grundgedanke: erst Wärmepläne, dann Heizungen.
Welche Fristen gibt das GEG vor?
Gem. § 71 Abs. 8 GEG gilt grundsätzlich, dass das 65 Prozent-Erfordernis gilt:
- mit Ablauf des 30. Juni 2026 in Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern, § 71 Abs. 8 S. 1 GEG
- mit Ablauf des 30. Juni 2028 in Kommunen mit 100.000 Einwohnern oder weniger, § 71 Abs. 8, S. 1 GEG
- einen Monat nach Erlass einer Entscheidung der Gemeinde über die Ausweisung eines Neu- oder Ausbaugebietes eines Wärmenetzes bzw. Wasserstoffnetzes auf Grundlage einer kommunalen Wärmeplanung (also nicht durch den Erlass eines kommunalen Wärmeplans selbst). In diesem Fall gilt das 65-Prozent-Erfordernis noch vor Ablauf des 30. Juni 2026 bzw. des 30. Juni 2028, § 71 Abs. 8 S. 3 GEG
Die aufgrund einer Bundesförderung bestehenden Wärmepläne müssen gem. § 5 Abs. 2 Nr. 2 WPG spätestens bis zum Ablauf des 30.06.2026 erstellt und veröffentlicht werden.
Dies hat keine Auswirkungen auf die Fristen des GEG.
Für Wärmepläne die mithilfe einer Bundesförderung erstellt wurden (bspw. gefördert durch die Kommunalrichtlinie/“ZUG-Förderung“), enthält § 26 Abs. 4 WPG eine Sonderregelung. Darin ist geregelt, dass ein solcher Wärmeplan einem Wärmeplan ohne Bundesförderung gleich steht. Daraus folgt, dass ein mit durch den Bund geförderter Wärmeplan keine gesonderten Wirkungen bei den Fristen des GEG auslöst.
Die Erstellungs- und Veröffentlichungsfristeines mit Bundesmitteln geförderten Wärmeplans in § 5 Abs. 2 WPG steht unabhängig von den Fristen in § 71 Abs. 8 GEG (siehe zu diesen Fristen „Hat das Bestehen einer Kommunalen Wärmeplanung Auswirkungen auf die Fristen des GEG?“).
Wichtig:
- Die Frist in § 5 Abs. 2 Nr. 2 WPG bezieht sich allein auf den mit Bundesmitteln geförderten Wärmeplan,
- Die Regelung des § 71 Abs. 8 S. 3 GEG bezieht sich auf die Entscheidung über die Ausweisung eines Neu- oder Ausbaugebietes eines Wärmenetzes bzw. Wasserstoffnetzes.
Folglich gilt für Gemeinden (die einen durch eine Bundesförderung geförderten Wärmeplan erstellt haben) für die Einhaltung des in § 71 Abs. 1 GEG geregelten 65%-Erfordernisses grundsätzlich:
- Für die Gemeinden über 100.000 EW die Frist des 30.06.2026, § 71 Abs. 8 S. 1 GEG
- Für die Gemeinden unter 100.000 EW die Frist des 30.06.2028, § 71 Abs. 8 S. 2 GEG
- Einen Monat nach Erlass einer Entscheidung der Gemeinde über die Ausweisung eines Neu- oder Ausbaugebietes eines Wärmenetzes bzw. Wasserstoffnetzes auf Grundlage einer kommunalen Wärmeplanung noch vor Ablauf des 30.06.2026 bzw. des 30.06.2028, § 71 Abs. 8 S. 3 GEG
Auf die Anforderungen des § 26 Abs. 4 S. 3 WPG zur Ausweisung eines Wärmenetzes bzw. Wasserstoffnetzes bei Gemeinden, die einen Wärmeplan i.S.d. § 5 Abs. 2 WPG erstellen/erstellt haben, möchten wir noch ergänzend hinweisen.
Wasserstoff in der Wärmeplanung
Die Entscheidung über die Ausweisung von Wasserstoffnetzausbaugebieten ist sehr individuell von den jeweiligen Voraussetzungen vor Ort abhängig. In jedem Fall empfiehlt es sich mit dem örtlichen Gasnetzbetreiber frühzeitig in Austausch zu treten. Im Zweifelsfall sieht das WPG die Einordnung als Prüfgebiet vor, was bis zum Zieljahr 2045 überprüft werden muss. Damit verschließt sich die Kommune keine Optionen und legt sich trotzdem nicht voreilig auf die Versorgungsoption Wasserstoff fest.
Fristen
Das Wärmeplanungsgesetz (WPG) setzt für die Erstellung der Kommunalen Wärmeplanung Fristen fest, die sich nach der Einwohnerzahl der einzelnen Kommune richten.
- Mehr als 100.000 Einwohner: bis 30. Juni 2026
- Weniger als 100.000 Einwohner: bis 30. Juni 2028
Hinweis ZUG-Förderung:
Nimmt eine Gemeinde die sog. ZUG-Förderung in Anspruch, besteht die Verpflichtung durch den Fördergeber, den kommunalen Wärmeplan bis spätestens 30.06.2026 zu erstellen.
Am 1. Januar 2024 ist das Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (WPG) des Bundes in Kraft getreten. Es verpflichtet die Länder sicherzustellen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet kommunale Wärmeplane erstellt werden. Die dafür erforderlichen gesetzlichen Regelungen in Bayern wurden in die Verordnung zur „Ausführung energiewirtschaftlicher Vorschriften“ aufgenommen und am 18. Dezember 2024 im Kabinett beschlossen. Sie sind am 2. Januar 2025 in Kraft getreten.
Damit sind die Gemeinden verpflichtet, einen Wärmeplan nach den Vorgaben des Wärmeplanungsgesetzes zu erstellen.
Für Bürgerinnen und Bürger
Allein durch die Kommunalen Wärmeplanung ergeben sich keine Änderungen für die Bürgerinnen und Bürger. Die Kommunale Wärmeplanung ist lediglich ein Planungsinstrument, mit dem die Hausbesitzer Planungssicherheit im Hinblick auf künftige Wärmeversorgungsoptionen erhalten können.
Heizkessel, die mit einem flüssigen oder gasförmigen Brennstoff beschickt werden und vor dem 1. Januar 1991 eingebaut oder aufgestellt wurden, dürfen nicht mehr betrieben werden und müssen daher grundsätzlich ausgetauscht werden (vgl. § 72 Abs. 1 GEG). Jüngere Heizungen (Einbau oder Aufstellung nach dem 1. Januar 1991) dürfen nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden (vgl. § 72 Abs. 2 GEG). Ausnahmen bestehen etwa für Niedertemperatur-Heizkessel, Anlagen mit einer geringen Nennleistung oder Hybridheizungen (vgl. § 72 Abs. 3 GEG).
Mit Ablauf des Jahres 2044 ist es endgültig verboten, Heizkessel mit fossilen Brennstoffen zu betreiben (vgl. § 72 Abs. 4 GEG). Sie müssen also entweder ausgetauscht oder mit 100 Prozent klimaneutralen Brennstoffen betrieben werden.
Bis zum Abschluss der Kommunalen Wärmeplanung können Eigentümer von Bestandsgebäuden grundsätzlich weiterhin frei darüber entscheiden, welche Heizung sie im Falle eines Austauschs neu einbauen.
Das Erfordernis von 65 Prozent erneuerbarer Energien (§ 71 Abs. 1 GEG) an der bereitgestellten Wärme gilt für neu einzubauende Heizungen im Bestand erst mit Ablauf der sog. Übergangsfristen:
- Ablauf des 30.06.2026 in Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern
- Ablauf des 30.06.2028 in Kommunen mit 100.000 Einwohnern oder weniger
Das Erfordernis von 65 Prozent gilt schon früher, wenn die Gemeinde während der Übergangsfrist in Folge eines Wärmeplans die Entscheidung über die Ausweisung eines Neu- oder Ausbaugebietes eines Wärmenetzes bzw. Wasserstoffnetzes trifft. In diesem Fall gilt das 65 Prozent-Erfordernis für Bestandsgebäude bereits einen Monat nach Bekanntgabe dieser Entscheidung (vgl. hierzu insgesamt § 71 Abs. 8 GEG).
Heizungen, die mit flüssigem oder gasförmigem Brennstoff beschickt und die während dieser Übergangsfrist eingebaut werden, müssen beginnend ab 2029 jedoch mit einem stetig steigenden Anteil an Biomasse oder grünem oder blauem Wasserstoff betrieben werden (zunächst 15 Prozent, vgl. § 71 Abs. 9 GEG).
Bis zum tatsächlichen Anschluss an ein Wärmenetz oder Wasserstoffnetz gelten anschließend an oben benannte Fristen weitere Übergangsfristen (vgl. § 71j, 71k GEG).

